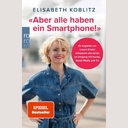Unternehmer*innen für eine enkeltaugliche Wirtschaft von morgen
Totale Verblödung?
Wie KI und Selbstentmündigung zusammenhängen können

„Die größte Gefahr der KI besteht vermutlich nicht darin, dass sie uns eines Tages vernichtet, sondern dass sie uns zuvor verblödet.“
So formuliert es die Philosophin Rebekka Reinhardt im Human-Magazin (Juli-Ausgabe). Schon heute, so Reinhardt, könne man beobachten, wie Menschen ihre eigenen Denkleistungen an Maschinen delegieren – wozu noch eine Hausarbeit selbst schreiben oder ein Problem eigenständig lösen, wenn ChatGPT das schneller und (scheinbar) besser kann?
Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat dieses Phänomen schon vor rund 15 Jahren auf den Punkt gebracht: Er sprach von der „Verhausschweinung des Menschen“.
Gefahren, die schon jetzt bei der Selbstbeobachtung in der Nutzung von KI und beim intensiveren Nachdenken über weitere Konsequenzen aufscheinen:
- Verlust von Grundfähigkeiten
Wenn wir uns zu sehr auf KI verlassen, verlieren wir nach und nach Fähigkeiten wie logisches Denken, Textverständnis, Handschrift, Kopfrechnen oder das strukturierte Recherchieren – ähnlich wie Navigationsgeräte viele Menschen die Orientierung ohne Karte verlernen lassen. - Abnehmende Frustrationstoleranz
KI liefert in Sekunden Antworten. Wer daran gewöhnt ist, verliert leicht die Geduld für längere, komplexe Denkprozesse oder für mühsames Ausprobieren – dabei entsteht oft genau daraus tieferes Lernen. - Schwächung des kritischen Denkens
Wenn wir KI-Antworten unreflektiert übernehmen, trainieren wir weniger, Aussagen zu hinterfragen, Quellen zu prüfen oder Widersprüche zu erkennen. Die Fähigkeit, selbst zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, erodiert. - Homogenisierung des Denkens
KI arbeitet auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und Mainstream-Mustern. Wer sich nur darauf verlässt, bekommt oft „mittelmäßige Mittelwerte“ statt origineller Ideen – was Kreativität und Vielfalt bremst. - Abhängigkeit statt Selbstermächtigung
Je mehr wir Alltagsentscheidungen an Algorithmen auslagern (Was soll ich essen? Welchen Job soll ich annehmen? Wohin fahre ich in den Urlaub?), desto mehr geben wir Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ab.
Gerade dies ist ein schleichender Prozess, in dem wir gar nicht merken, wie wir Entscheidungen aus Bequemlichkeit einfach abgeben. Doch wie oft folgen wir GoogleMaps völlig unhinterfragt auf der "besten Route" oder gehen in Restaurants, die uns eine App "empfiehlt" und denken gar nicht erst über Alternativen nach oder testen diese. Je öfter wir auf algorithmische Empfehlungen setzen, desto weniger trainieren wir, Alternativen zu suchen oder eigene Kriterien zu entwickeln. Mit der Zeit verlernen wir, Entscheidungen selbst zu strukturieren, weil wir uns daran gewöhnen, dass „etwas anderes“ das vorsortiert. - Erosion von Lern- und Erinnerungsprozessen
Wenn Wissen jederzeit abrufbar ist, fehlt der Anreiz, es zu speichern oder tiefer zu verankern. Das macht uns oberflächlicher im Denken, weil wir Zusammenhänge nicht mehr im eigenen Kopf aufbauen. - Illusion des „Alles-Wissens“
KI kann ein Gefühl vermitteln, dass man jede Antwort parat hat – was gefährlich ist, wenn das Wissen nicht verinnerlicht oder überprüft ist. Das Risiko von Fehleinschätzungen und Scheinexpertise steigt und wir produzieren Unmengen von Text, der "schlau daherkommt", doch bei genauerem Hinsehen nur wenig Substanz hat.
KI: Spiegel unserer Haltung
Wie wir KI nutzen, sagt viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft mit Wissen, Verantwortung und Bequemlichkeit umgehen.
Die Versuchung ist groß, Antworten einfach abzurufen, statt selbst zu denken. Doch genau das macht uns abhängig – und anfällig, Fähigkeiten und Urteilsvermögen zu verlieren.
Selbstverantwortung in der Nutzung heißt: nicht jede bequeme Lösung akzeptieren, sondern Fragen stellen, nachhaken, Widersprüche suchen. Es heißt auch, bewusst zu entscheiden, wann menschliche Reflexion unverzichtbar ist – gerade bei ethischen oder gesellschaftlich relevanten Themen.
Genauso wichtig ist die Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien, nach denen KI entwickelt wird:
Wer legt fest, welche Informationen sie liefert? Welche Perspektiven werden einbezogen – und welche nicht? Welche Werte stecken im System, oft unsichtbar, aber wirksam?
KI ist nicht nur ein Werkzeug, das wir individuell „richtig“ oder „falsch“ einsetzen. Sie ist auch ein Produkt gesellschaftlicher Entscheidungen – über Transparenz, Vielfalt, Verantwortung und Machtverteilung.
Deshalb tragen wir als Nutzer*innen nicht nur Verantwortung für unseren persönlichen Umgang mit ihr, sondern auch für die Rahmenbedingungen, unter denen sie entsteht.
Individuelle Verantwortung ist unverzichtbar – UND: sie wirkt stets im Rahmen der Spielregeln, die wir als Gesellschaft festlegen.
Wenn wir den Einsatz von KI allein den Entwickler*innen (meist sind es jedoch Entwickler), Konzernen oder Staaten überlassen, überlassen wir ihnen auch, welche Werte, Interessen und Perspektiven in diese Systeme einfließen.
Deshalb braucht es einen öffentlichen Diskurs darüber, welche Art von Technologie wir wollen – und welche wir ablehnen.
Unsere Haltung als Einzelne ist der Anfang – unsere Bereitschaft, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen, entscheidet, ob KI zu einer Kraft für Mündigkeit und Kreativität wird oder zu einer weiteren Maschinerie, die uns bequem und berechenbar macht.
Genau deshalb dürfen wir die Auseinandersetzung mit KI nicht auf den privaten Gebrauch beschränken.
Wir brauchen eine offene, breite gesellschaftliche Debatte darüber, welche Prinzipien und Werte in diese Technologie einfließen sollen – und welche Grenzen wir ihr setzen wollen.
Diese Debatte muss über Fachkreise hinausgehen. Sie betrifft nicht nur Entwickler*innen, Politik oder Wirtschaft, sondern jede und jeden von uns. Denn KI ist nicht irgendein Werkzeug – sie wird unsere Art zu arbeiten, zu lernen, zu entscheiden und zu leben prägen.
Es liegt an uns, ob wir KI nutzen, um als Gesellschaft klüger, kreativer und freier zu werden – oder ob wir zulassen, dass sie uns bequemer, abhängiger und manipulierbarer macht.
Lasst uns jetzt darüber sprechen, bevor andere die Antworten für uns festlegen.
Es geht um Grundsatzfragen:
- Soll KI vor allem effizienter machen oder auch gerechter?
- Soll sie menschliche Fähigkeiten ersetzen oder erweitern?
- Wie stellen wir sicher, dass Vielfalt, Transparenz und Verantwortung nicht nur schöne Worte in Strategiepapieren bleiben, sondern verbindliche Leitlinien werden?
Unsere Haltung als Einzelne ist der Anfang – unsere Bereitschaft, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen, entscheidet, ob KI zu einer Kraft für Mündigkeit und Kreativität wird oder zu einer weiteren Maschinerie, die uns bequem und berechenbar macht.
Genau deshalb dürfen wir die Auseinandersetzung mit KI nicht auf den privaten Gebrauch beschränken.
Wir brauchen eine offene, breite gesellschaftliche Debatte darüber, welche Prinzipien und Werte in diese Technologie einfließen sollen – und welche Grenzen wir ihr setzen wollen.
Diese Debatte muss über Fachkreise hinausgehen. Sie betrifft nicht nur Entwickler*innen, Politik oder Wirtschaft, sondern jede und jeden von uns. Denn KI ist nicht irgendein Werkzeug – sie wird unsere Art zu arbeiten, zu lernen, zu entscheiden und zu leben prägen.
Es liegt an uns, ob wir KI nutzen, um als Gesellschaft klüger, kreativer und freier zu werden – oder ob wir zulassen, dass sie uns bequemer, abhängiger und manipulierbarer macht.
Lasst uns jetzt darüber sprechen, bevor andere die Antworten für uns festlegen.
Informationen
Veröffentlicht am 08. August 2025